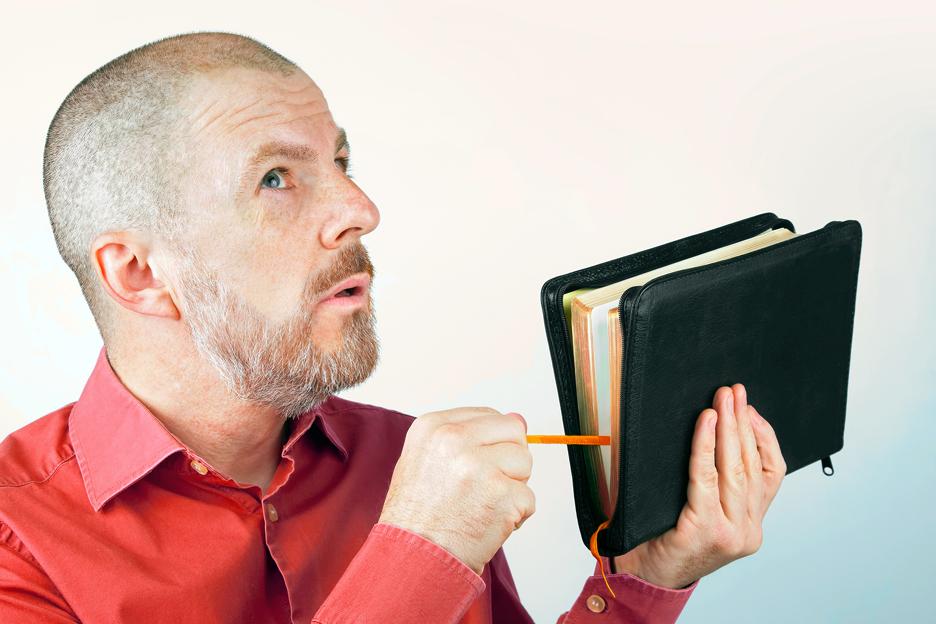
Auf Kritiker des Christentums üben sie seit jeher eine grosse Faszination aus: die sogenannten «apokryphen Evangelien». Evangelien, die, so sagt man, eine übermächtige Kirche aus der Bibel entfernt habe, um die wirkliche Wahrheit über Jesus zu vertuschen. Schon Gotthold Ephraim Lessing (1726–1781) vermutete 1778, dass das sogenannte «Nazarenerevangelium», von dem schon die Kirchenväter erzählten, das älteste und ursprünglichste Evangelium gewesen sei. Die vier Evangelien des heutigen Neuen Testaments seien dagegen lediglich spätere Überarbeitungen und Erweiterungen dieses einen «Urevangeliums». Lessing wurde mit seiner These zu einem wichtigen Impulsgeber der modernen kritischen Bibelforschung. Denn wo es ein «ursprüngliches» (wenn auch leider inzwischen «verlorenes») Evangelium gab, da konnte man auch über ein «ursprüngliches» und inzwischen durch die Kirche verfälschtes Bild von Jesus spekulieren.
Das kirchenkritische Interesse an den apokryphen Evangelien hat deshalb auch seit Lessings Tagen wenig nachgelassen. Erst 2021 veröffentlichte der renommierte Fernsehjournalist Franz Alt sein Enthüllungsbuch «Die aussergewöhnlichste Liebe aller Zeiten: Die wahre Geschichte von Jesus, Maria Magdalena und Judas» (Herder). Es landete prompt auf der Bestsellerliste des Magazins «Spiegel». Aus den Evangelien des Philippus, des Judas und der Maria Magdalena rekonstruiert der in die Jahre gekommene Friedens-, Umwelt- und Feminismusaktivist hier ein Jesusbild, das überraschenderweise in allen Punkten seine eigenen Ideale vertritt. Was also hat es auf sich mit all diesen unterschiedlichen «alternativen Evangelien»? Wie ist ihr historischer Wert zu beurteilen, und wie geheim sind sie wirklich?
Vorsicht Verwechslungsgefahr!
Das Wichtigste gleich am Anfang: In der Bibelwissenschaft spricht man zwar von den «neutestamentlichen Apokryphen», und dazu zählen auch die meisten der genannten Evangelien: Aber trotz des gleichen Namens darf man sie nicht verwechseln mit den Apokryphen des Alten Testaments – zum Beispiel den Büchern Tobit, Judit oder Makkabäer. Nicht nur deshalb, weil sie aus einer ganz anderen Zeit stammen, sondern auch weil ihre Einordnung als Apokryphen ganz andere Ursachen hat als im Alten Testament.
Während die Apokryphen des Alten Testaments bis zur Reformationszeit als ganz selbstverständlicher Teil der christlichen Bibel galten, war das bei den Apokryphen des Neuen Testaments nie der Fall. Martin Luther (1483–1546) ordnete die Apokryphen des Alten Testaments zwar als Anhang hinter die übrigen Schriften des Alten Testamens: Er empfahl sie aber dennoch als «gut und nützlich zu lesen». Das hätte er von den neutestamentlichen Apokryphen nie gesagt. Während die alttestamentlichen Apokryphen von den ersten Christen als Quelle jüdischer Weisheit und jüdischen Glaubens geschätzt wurden, wurden die meisten Schriften, die wir heute neutestamentliche Apokryphen nennen, von den führenden Lehrern des frühen Christentums von Anfang an als Irrlehre bekämpft oder Fälschung abgelehnt. Man muss also zwischen neu- und alttestamentlichen Apokryphen klar unterscheiden.
Eine schillernde Vielfalt
Die neutestamentlichen Apokryphen unterscheiden sich auch deshalb von den alttestamentlichen, weil sich ihre Zahl kaum klar erfassen oder eingrenzen lässt. Während die Zahl bei den alttestamentlichen Apokryphen je nach Bibelausgabe insgesamt etwa zwischen zehn und 15 schwankt, zählen wir allein mehr als 40 apokryphe Evangelien. Hinzu kommen etwa acht Sammlungen von lose überlieferten Jesusworten, über 20 alternative Apostelgeschichten (zum Beispiel die Taten des Andreas, des Johannes, des Petrus, des Paulus und der Thekla usw.); ausserdem drei apokryphe Apostelbriefe, einen ausführlichen «Briefwechsel» von insgesamt 14 Briefen, angeblich zwischen Paulus und dem berühmten römischen Philosophen Seneca. Und schliesslich mindestens fünf «Offenbarungen», die unter anderem Paulus, Petrus und Thomas zugeschrieben werden.
Aber auch in ihrem Charakter und ihrer Herkunft sind diese Schriften völlig unterschiedlich: Das «Thomasevangelium» etwa stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus (manche Forscher vermuten sogar das 1. Jahrhundert) und enthält tatsächlich viele authentische Jesusworte, die sich ebenfalls in den vier offiziellen Evangelien finden. Allerdings finden sich daneben eben auch viele befremdliche Aussagen Jesu. Etwa die, dass Frauen nur dann ins Reich Gottes kommen können, wenn sie «zu Männern werden» (EvThom. 114). Das «Barnabasevangelium» dagegen, das einen sehr muslimischen Jesus zeigt und sich deshalb bei Muslimen weltweit grosser Beliebtheit erfreut, entstand erst im 14. Jahrhundert. So wundert es nicht, dass Jesus hier das Kommen des Propheten Mohammed namentlich ankündigt und schon Adam das islamische Glaubensbekenntnis (shahada) spricht.
Nur wenige der apokryphen Evangelien sind heute tatsächlich noch im Wortlaut erhalten. Viele kennen wir nur noch dem Namen nach, weil antike Autoren sie am Rande erwähnen, ohne daraus zu zitieren. Von manchen kennen wir einzelne Verse, weil sie von Kirchenvätern zitiert werden. Manche der Schriften wurden erst im 19. oder 20. Jahrhundert bei archäologischen Ausgrabungen oder in alten Bibliotheken entdeckt und waren vorher unbekannt.
Eine besondere Sensation war der Zufallsfund eines ägyptischen Bauern, der 1945 in der Nähe von Nag Hammadi am Nil einen Tonkrug mit 13 antiken Lederbänden aus dem 4. Jahrhundert entdeckte. Neben einer Anzahl von nichtchristlichen und vorchristlichen Schriften – etwa des Philosophen Plato (428/427–348/347 v. Chr.) – enthielten diese Bände auch viele christliche Texte. Darunter war etwa das Thomasevangelium, das Philippusevangelium, das «Ägypterevangelium» und das «Evangelium der Wahrheit».
Was steht drin?
So geheim, wie häufig behauptet, sind die neutestamentlichen Apokryphen nicht. Im Buchhandel sind sie schon seit über 100 Jahren für jeden zugänglich. Auch neue Funde, wie etwa die Nag Hammadi-Schriften, sind jeweils zeitnah veröffentlicht worden.
Lesen Sie den ganzen Artikel in ethos 05/2025